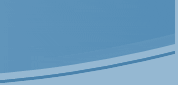| lingenergeschichte |
Die folgenden Darstellungen zur Lingener und emsländischen Geschichte haben wir aus lokalen Literaturquellen entnommen, sie stammen nicht aus eigener Feder:
Die Lingener Geschichte
975
Erste urkundliche Erwähnung; Kaiser Otto II. weilt in Lingen auf der Curia; vorübergehend ist Lingen Sitz der Kaiserlichen Verwaltung.
1372
Die Zeiten sind kriegerisch. In höchster Not wird eine Bürgerwehr aus kaum erwachsenen Jünglingen gegründet. Tapfer verteidigen sie ihre Heimat und verhindern, daß der Feind die Stadt erobert. So retten sie Frauen, Kinder und ihre älteren Mitbürger - die "Kivelinge".
1520
Graf Nikolaus IV. von Tecklenburg sorgt für Angst und Entsetzen im Land. Er war ein wilder Herrscher, der Lingen, eine Stadt, die bereits eine Reitpoststrecke besaß, zur Festung ausbaute. Damit bestimmte er wesentlich den Grundriß der heutigen Altstadt mit. Doch durch sein Bauwerk ließ er Lingen auch zur Zielscheibe für allerlei besitzergreifende fremde Heere werden.
1548
Die Stadt wird von einer schweren Feuersbrunst heimgesucht und fast völlig zerstört. In den folgenden Jahren wird das Rathaus wieder aufgebaut. Es erhält durch Umbauten von 1663 und 1772 sein heutiges Aussehen.
1597
Lingen wird wird von den Oraniern eingenommen.
1605
Der spanische Feldherr Spinola erobert Lingen.
1632
Schleifung der Festungswerke
1648
In Münster und Osnabrück wird der westfälische Friede zur Beendigung des 30jährigen Krieges geschlossen. Danach gehörte Lingen wieder zum oranischen Reich.
1653
Karl V. richtet 1550 / 51 eine Postanstalt ein; 1653 wird die heute noch bestehende Posthalterei am Markt erbaut.
1697
Der Oranier Wilhelm III. beurkundet die Gründung einer kleinen Universität mit den vier klassischen Fakultäten.
1702
Der oranische Landrichter und preußische Geheimrat Thomas Ernst von Dankelmann nimmt Besitz von Stadt und Grafschaft Lingen.
1752
Ab 1550 ist in Lingen ein Drostenamt besetzt; ab 1702 ist die Stadt Regierungssitz; von 1752 bis 1762 ist von Loen, ein Verwandter Goethes, Regierungspräsident in Lingen.
1856
Die Bahnstrecke Rheine-Emden wird eröffnet.
1892
Baubeginn des Dortmund-Ems-Kanals, der 1899 für den Schiffsverkehr freigegeben wird.
1927
Am 1.Juni tobt die bis heute unvergessene Sturmkatastrophe.
1956
Lingen wird Garnisionsstadt
1970
Freiwilliger Zusammenschluß von Darme, Laxten und Brockhausen mit Lingen.
1974
Gemeindereform: Zu Lingen kommen die Samtgemeinden Bramsche und Baccum, die Gemeinde Altenlingen, Brögbern, Holthausen-Biene, Clusorth-Bramhar und der Ortsteil Schepsdorf.
1977
Lingen wird "Große selbständige Stadt" und verliert den Kreissitz; Seitdem gehört Lingen zum Landkreis Emsland. 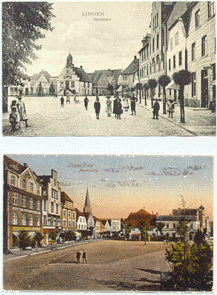 alte Ansichten des Lingener Marktplatzes
alte Ansichten des Lingener Marktplatzes
Die Geschichte der Grafschaft Lingen
Die 1493 von Otto und Nikolaus, den Söhnen des Grafen Nikolaus III. von Tecklenburg, als Altersversorgung für ihren Vater von der Grafschaft Tecklenburg abgetrennte Herrschaft Lingen, sollte nach dessen Tod an die Grafschaft Tecklenburg zurückfallen. Bei einer Teilung der Einkünfte und Nutzungsrechte der Grafschaft Tecklenburg zwischen den beiden Söhnen des verstorbenen Grafen Nikolaus III. erhielt Nikolaus der IV. 1496 die Herrschaft Lingen, die spätere Niedergrafschaft,und vermutlich auch die vier Kirchspiele Ibbenbüren, Recke, Mettingen und Halverde mit Brochterbeck, die spätere Obergrafschaft Lingen. Im Jahre 1515 hatte jedoch der Graf Otto von Tecklenburg wieder die Landeshoheit über die vier Kirchspiele inne. Der genaue Zeitpunkt des Anschlusses dieser vier Kirchspiele und ihre Zugehörigkeit zur Herrschaft Lingen in diesen Jahren ist bis heute umstritten. Unumstritten ist aber, daß zu diesem Zeitpunkt nur eine Teilung der Nutzungsrechte und Einkünfte stattgefunden hatte. Es war keine sog. "Totteilung", also Trennung der Grafschaft Tecklenburg und der Herrschaft Lingen, erfolgt. Zu vermuten ist jedoch, daß in der Zeit der Herrschaft der Grafen Nikolaus III. und IV. sich die Bezeichnung Grafschaft für die Herrschaft Lingen gebildet hat, wie sie dann nach der Trennung von der Grafschaft Tecklenburg auch in offiziellen Schreiben benutzt wurde.
Im Jahre 1518 wurde die Grafschaft Lingen vom Bischof von Münster besetzt, der entflohene Graf Nikolaus übergab, auf der Suche nach Unterstützung, darauf 1526 die Herrschaft Lingen als Lehen an den Herzog Egmont von Geldern. Es ist hierbei zweifelhaft, ob der Graf hierzu überhaupt berechtigt war, denn im Vertrag mit seinem Bruder waren ja nur die Einkünfte und die Nutzungsrechte geteilt worden und nicht die Grafschaft Tecklenburg an sich. Kurzfristig hatte diese Handlung des Grafen auch Erfolg, denn der Bischof von Münster wich einer Machtprobe mit dem Herzog von Geldern aus. Graf Konrad, Erbe seines Vaters und seines Onkels, unter dessen Herrschaft Tecklenburg wieder vereint war, schloß sich dem Schmalkaldischen Bund und somit der Reformation an. Aber mit Kaiser Karl IV., gleichfalls König von Spanien, Herzog von Burgund und Erbe des Hauses Habsburg, stand ihm ein starker Gegner gegenüber. Als Erbe des Herzogs von Geldern konnte er sich zudem auch als Lehnsgeber der Herrschaft Lingen bezeichnen, welche er dem geldrischen Lehen zuteilte. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung wurde Graf Konrad am 18. Oktober 1546 der Acht unterworfen. Er verlor dadurch zunächst alle seine Güter und Herrschaftsansprüche.
1547 belehnte Karl V. den Grafen Maximilian von Büren u.a. mit der Herrschaft Lingen einschließlich der vier Kirchspiele. 1551 kaufte er sie aber für 120.000 Karlsgulden dessen Tochter wieder ab, nachdem deren Vater verstorben war. Auch nach Beendigung der Friedensverhandlungen am 5. März 1548 erhielt Graf Konrad nur die Herrschaftsgebiete seines Vaters, Tecklenburg und Rheda, zurück. Die Herrschaft Lingen und die vier Kirchspiele waren verloren. Von diesem Zeitpunkt an war die Grafschaft Lingen ein von der Grafschaft Tecklenburg endgültig getrenntes Herrschaftsgebiet. Mit der Verwaltung des nunmehr Grafschaft Lingen genannten Gebietes betraute Karl V. die Statthalterin der Niederlande, seine Schwester Maria. Dieses Gebiet bildete jedoch keine räumliche Einheit, es wurde durch das weiterhin zu Tecklenburg gehörende Kirchspiel Schale in zwei Teile, in die Ober- und Niedergrafschaft Lingen, getrennt. Der Nachfolger Karls V., sein Sohn König Philipp II., beließ die Verwaltung in den Niederlanden bei seiner Schwester Margarete von Parma.
Im Jahre 1578 übergaben die Generalstaaten der Niederlande, mit der Einwilligung des Kaisers, die Grafschaft Lingen dem Statthalter Willem I. von Oranien als Taufgeschenk. Die genaueren Umstände dieses Taufgeschenkes sind bis heute historisch nicht eindeutig geklärt. Zum Zeitpunkt der Schenkung war die Grafschaft Lingen nicht im Besitz der Generalstaaten, sondern weiterhin in der des Kaisers. Von da an war dennoch die Grafschaft Lingen eng mit dem Schicksal des oranisch-nassauischen Königshauses verbunden und somit auch Leidtragende im 80 Jahre dauernden Spanisch-Niederländischen Krieg. Erst 1597 war der Sohn von Willem, Moritz von Oranien, in der Lage, Lingen zu besetzen. Dem Kriegsglück entsprechend wechselten sich in den folgenden Jahrzehnten die Beherrscher der Grafschaft Lingen ab. Damit verbunden war jedesmal ein Wechsel der Verwaltung und der Konfession des Landesherrn, welche dieser dann auf die Einwohner der Grafschaft zu übertragen versuchte. Die Grafschaft war während dieser Zeit wechselseitigen Plünderungen von der einen oder anderen Kriegspartei ausgesetzt. Aus dieser Zeit sind jedoch kaum Erwähnungen Mettingens im Zusammenhang mit Kriegshandlungen zu finden, die größere Entfernung zu den damaligen Hauptverkehrswegen war für Mettingen sicherlich von Vorteil. Es ist jedoch falsch, vom Fehlen schriftlicher Belege auf eine vollkommene Verschonung des Ortes zu schließen.
Am 19. August 1605 eroberten die kaiserlich-spanischen Truppen unter Ambrosius Spinola Lingen zurück. Bis zum 6. Januar 1633 befand sich die Grafschaft Lingen in kaiserlicher Hand. In dieser Zeit gab es eine starke gegenreformatorische Bewegung, welche wieder die katholische Konfession unterstützte.
Nach 1633 wurde die Grafschaft erneut oranischer Besitz, zunächst treuhänderisch bis zur Beendigung des Dreißigjährigen Krieges 1648, danach als oranischer Besitz bis 1702, nur unterbrochen von einer zweijährigen Besetzung der Grafschaft Lingen durch den Bischof von Münster 1672-1674. In der Zeit nach 1674 setzten starke reformatorische Bestrebungen ein, die jedoch in der katholischen Grafschaft auf Wiederstände stießen. Zu berücksichtigen ist dabei, daß, bedingt durch die politisch-geographisch Lage, die katholischen Einwohner der Grafschaft über Unterstützung in Fragen der Religion außerhalb der Grafschaft und über Ausweichmöglichkeiten beim Feiern der katholischen Gottesdienste verfügten. Die Grafschaft war von katholisch münsterischen und osnabrückischen Landen sowie dem weniger strengen evangelischen Tecklenburger Gebiet umgeben. Die Einwohner Mettingens verließen die Obergrafschaft Lingen entweder in Richtung Norden zum Hochstift Osnabrück oder in Richtung Osten nach Westerkappeln in der Grafschaft Tecklenburg, um dort ihre Gottesdienste zu feiern. In diesem Zusammenhang verweisen sowohl Rickelmann als auch Goldschmidt auf Gottesdienste auf einem Westerkappelner Kamp namens Hermeling Rott (Rickelmann mundartlich Hiemmelkroat), auch Helmigrode (Goldschmidt)genannt. Dieser Kamp könnte mit dem Flurnamen hinter den Himmlingrot (Urkataster) identisch sein.
Am 25. März 1702 übernahm der preußische König die Regentschaft in der Grafschaft Lingen, nachdem am 17. März festgelegt worden war, daß, sollte Willem kinderlos sterben, seine ältere Schwester Luise Henriette Erbin der oranischen Besitztümer sein sollte. Sie war verheiratet mit dem Kurfürsten Friedrich von Brandenburg. Ihr Sohn, Friedrich I. von Preußen, sicherte sich daraufhin unverzüglich die Grafschaft Lingen, obwohl die Generalstaaten protestierten. Im Jahre 1707 wurde Lingen sodann mit dem inzwischen ebenfalls preußischen Tecklenburg vereinigt. Lingen wurde nun Sitz der Lingisch-Tecklenburgischen Regierung. Nach diesem Wechsel in der Landeshoheit setzte schrittweise auch eine Verbesserung in Fragen der Religionsausübung in der Grafschaft ein. Schrittweise wurde den Katholiken im Verlauf der folgenden 100 Jahre die Religionsausübung gestattet.
Während der Napoleonischen Kriege wurde auch die Grafschaft Lingen von französischen Truppen besetzt. Sie wurde zunächst dem Großherzogtum Berg (Mettingen ab 1808-13.12.1810), später direkt dem französischen Staatsgebiet (Mettingen ab 13.12.1810) zugeschlagen. Im Jahre 1813 übernahm Preußen erneut die Herrschaft, trat aber die Niedergrafschaft Lingen an das Königreich Hannover ab, während es die Obergrafschaft Lingen mit dem preußischen Westfalen verband. Infolge des Sieges der Preußen im österreichisch-preußischen Krieges gelangte auch das Königreich Hannover 1866 unter preußische Kontrolle und somit die Niedergrafschaft erneut an Preußen. 
Vom Amt Meppen zum Landkreis Emsland (geschrieben von Herrn Heiner Schüpp, Leiter des Kreisarchivs Emsland)
Die Vorgängerbehörden der heutigen Kreisverwaltung reichen bis in das Mittelalter zurück. Das einzig verbindende ist dabei allerdings nur noch das Territorium Emsland; Legitimation, Aufgaben und Erscheinungsbild haben sich im Lauf der vergangenen Jahrhunderte erheblich gewandelt. Der Landkreis Emsland steht heute für ein fest umrissenes Gebiet, das sich von Salzbergen im Süden bis Papenburg im Norden und von Twist im Westen bis Vrees im Osten auf rd. 2.880 km² Fläche erstreckt. Er ist damit flächengrößter Landkreis Niedersachsens und zweitgrößter Landkreis der Bundesrepublik. Es gibt klare Grenzen zu den benachbarten Niederlanden, dem Bundesland Nordrhein-Westfalen, den Nachbarkreisen Leer, Cloppenburg, Osnabrück und Grafschaft Bentheim.
Das Emsland im Mittelalter
Das war nicht immer so. Der Name Emsland taucht in der schriftlichen Überlieferung des Mittelalters erstmals Ende des 13.Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Erwähnung des Drosten des Bischofs von Münster im Emsland auf. Den Drosten als Amtsverwalter des Bischofs hatte es schon vorher gegeben, erstmals erwähnt wurde er 1240. Seine Benennung war aber bis dahin immer auf seinen Amtssitz, die Burg Landegge, bezogen. Die Änderung der Benennung ist so bedeutsam, weil in diesem Vorgang die Anfänge einer flächendeckenden Herrschaft der Bischöfe von Münster faßbar werden, die 1252 mit dem Erwerb der ravensbergischen Besitzungen im Emsland den entscheidenden Schub erhalten hatte. Ende des 14. Jahrhunderts kann man vom Amt Meppen reden.
Grafen und Missionare
Vorausgegangen war dem ein herrschaftlicher Entwicklungsprozeß, der über fünf Jahrhunderte gedauert hatte. Die Eroberung des sächsischen Siedlungsraumes, zu dem auch das Gebiet um Ems und Hase gehörte, durch die Karolinger Ende des 8. Jahrhunderts, brachte eine entscheidende Veränderung des herrschaftlichen Gefüges mit sich. Karl d. Große teilte das Gebiet neu auf. Zwei Stränge bildeten dabei das Rückgrat der neu zu errichtenden Herrschaft. Die Gaue mit den Grafen als königlichen Herrschaftsvertretern an der Spitze waren die Grundlage der politischen Administration. Die Kirchenorganisation gründete sich dagegen auf Missionssprengel, die von Missionszellen als Kernorten die Missionierung des eroberten Gebietes organisierten. Hinter ihr standen in unserem Raum die neu gegründeten Bistümer Münster und Osnabrück.
Territorium und Herrschaft
Im Laufe des 9. und 10. Jahrhunderts zersplitterte sich die herrschaftliche Situation im Emsland stark. Neben grundherrliche Rechte, also Herrschaft, die an Eigentum am Boden gebunden war, traten verliehene Herrschaftsrechte, also Lehnsbesitz, ergänzt durch Rechte an Zoll, Münze und anderen Abgaben, die nicht selten auf Vertretungsrechten als Vogte gründeten, also der Wahrnehmung weltlicher Macht in Vertretung kirchlicher Herren. Ausgeübt wurde die Herrschaft hauptsächlich von den Familien der Grafen von Ravensberg und Tecklenburg, von den Bischöfen von Münster und Osnabrück und vom Abt des Klosters Corvey, der über den bedeutendsten Grundbesitz im Emsland verfügte. Herrschaftsmittelpunkte waren dabei die Hauptorte der Missionssprengel in Meppen und Aschendorf und die als feste Häuser errichteten Landesburgen Landegge und Fresenburg. Verschiedene Herrschaftsrechte wurden teilweise von denselben Familienverbänden ausgeübt und allmählich verdichtete sich in einigen Räumen die punktuelle zu einer mehr flächendeckenden Herrschaft. Die herrschaftliche Situation, wie sie sich um 1400 im Emsland präsentierte, blieb bis zum Reichsdeputationshauptschluß 1803 im wesentlichen unverändert.
Die Standesherrschaft der Herzöge von Arenberg
Die französischen Eroberungen links des Rheins während der Revolutionskriege brachten für die bislang dort herrschenden Fürstenhäuser teilweise erhebliche Gebietsverluste mit sich. Der Frieden von Lunèville 1801 sah eine Entschädigung dieser Fürsten durch Übereignung bislang geistlicher Herrschaften rechts des Rheins vor (Säkularisation). Im Zuge des sogenannten Reichsdeputationshauptschluß vom 25. Februar 1803 wurde auch das Fürstbistum Münster aufgeteilt. Den Hauptanteil erhielt Preußen, der Rest fiel an kleinere zu entschädigende Fürstenhäuser, wie das der Herzöge von Arenberg, die im Emsland das Amt Meppen erhielten. 1811 zunächst von den Franzosen, dann nach dem Wiener Kongreß von 1815 durch den König von Hannover als neuem Landesherrn mediatisiert, behielten die Herzöge von Arenberg in ihrem seit 1826 bestehenden Herzogtum Arenberg Meppen noch standesherrliche Rechte, wie die untere Zivil- und Strafgerichtsbarkeit, Schulaufsicht, Polizeiverwaltung. Die bisherige staatliche landrätliche Verwaltung des Kreises Meppen wurde aufgelöst; die Aufsicht über die von den arenbergischen Beamten ausgeübten "öffentlichen Funktionen übernahm der Landdrost in Osnabrück. Die herzogliche Verwaltung teilte die Standesherrschaft in vier sogenannte Mediatämter auf: Amt Meppen, Haselünne, Hümmling und Aschendorf. Nach der 1866 erfolgten Übernahme des Königreichs Hannover durch das Königreich Preußen wurde die arenbergische Standesherrschaft 1875 endgültig aufgelöst.
Die Übernahme Hannovers durch Preußen brachte auch das Amt Lingen zwischen 1702 und 1815 bereits einmal unter preußischer Herrschaft, danach auf dem Wiener Kongreß Hannover zugeschlagen wieder unter die Krone Preußens. Der Kreis Emsbüren, 1826 zunächst als Vogtei in das Amt Lingen eingeordnet, wurde endgültig in den neuen Großkreis Lingen eingegliedert.
Preußische Kreisreform 1885
Im Rahmen der gesamtstaatlichen Reformmaßnahmen trat zum 1. April 1885 auch für die nun preußische Provinz Hannover eine Kreisordnung in Kraft, die Anknüpfungspunkte an die heute selbstverwaltete Kommune 'Landkreis Emsland' zuläßt. Die in den alten Provinzen bereits 1872 eingeleitete Kreisreform Preußens war getragen von dem Grundgedanken, die aktive Selbstverwaltung auch auf dem Lande einzuführen, wie bereits in den Städten geschehen. Schul- und Armenkassen, Gesundheitspflege, Wohltätigkeitsanstalten und vor allem die wirtschaftliche Selbstverwaltung sollten aus der staatlichen Zuständigkeit in den selbstverwalteten Bereich der Kreise übergehen.
An der Spitze stand der Landrat als Staatsbeamter, der zwar vom König ernannt, aber vom Kreistag vorgeschlagen wurde. Dies gab dem Kreis eine Doppelgestalt. Neben den staatlichen Verwaltungsbezirk, der vom Landrat bürokratisch geleitet wurde, trat der Kreisverband als eine selbstverwaltungsmäßig aufgebaute und geleitete Gebietskörperschaft, deren Hauptorgane der Kreistag und der Kreisausschuß waren.
Auf der Grundlage der neuen Ordnung gab es im Emsland in Lingen, Meppen, Aschendorf und für den Hümmling in Sögel Kreisverwaltungen. Eine ihrer wichtigsten Funktionen war bereits damals, nach Möglichkeit für einen gerechten Ausgleich der Verhältnisse zu sorgen. Dabei kam dem Landrat als Mittler zwischen Staats- und Kommunalverband eine wichtige Rolle zu.
Kreisreform 1932
Durch Verordnung des preußischen Staatsministeriums wurden die bisherigen Kreise Aschendorf und Hümmling zum 1. Oktober 1932 aufgelöst und zu einem neuen Kreis Aschendorf Hümmling mit Sitz in Aschendorf zusammengeschlossen. Damit verbunden war gleichzeitig eine Gebietsänderung, denn aus dem Kreis Hümmling wurden die Gemeinden Ahmsen, Groß Berßen, Klein Berßen, Groß Stavern, Klein Stavern, Herßum, Holte, Lähden, Lastrup, Vinnen und Wachtum und aus dem Kreis Aschendorf die Gemeinden Emen und Tinnen dem Kreis Meppen zugeschlagen. Vom Kreis Meppen wurden die Gemeinden Schwartenpohl und Wachendorf in den Kreis Lingen eingegliedert.
Politischer Neubeginn 1945
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bauten die alliierten Besatzungstruppen sofort eine auf demokratischen Prinzipien fußende Verwaltung auf. Der politische Neubeginn sollte auch durch eine neue Verwaltungsstruktur unterstrichen werden. Die britische Militärregierung löste deshalb in ihrer Zone, zu der auch das Emsland gehörte, die bestehende landrätliche Verwaltung auf und ersetzte sie nach britischem Vorbild durch das Modell einer 'Doppelspitze'. Der nun ehrenamtlich tätige Landrat repräsentierte die politische Vertretung, die bereits 1946 wieder von der Bevölkerung frei gewählt werden konnte, und der hauptamtliche Oberkreisdirektor leitete als Hauptverwaltungsbeamter die Verwaltung. Durch den Erlaß des Niedersächsischen Ministerpräsidenten vom 14. Oktober 1947 wurde dieser Übergang, der die Geburtsstunde der Kreise als voll selbstverwalteter Kommunen bedeutete, rückwirkend auf den 1. April 1946 festgesetzt. Damit war ein Prozeß beendet, dessen Grundgedanken in den preußischen Staatsreformmodellen des 19. Jahrhunderts wurzelten.
Grundlagen der Gebiets- und Verwaltungsreform
Bei Politikern und Verwaltungsfachleuten wuchs seit Beginn der 60er Jahre die Einsicht, daß zur Bewältigung der Zukunftsaufgaben eine grundlegende Reform der Verwaltung und des gebietlichen Zuschnitts der Verwaltungsbezirke vorgenommen werden mußten. Ziel war es, vor allem um effektiver planen zu Können, größere Einheiten zu schaffen, Zuständigkeiten neu zu ordnen und die Qualität der Verwaltungsleistung zu verbessern. Die Verwaltung sollte leistungsfähiger werden, um die Dienstleistung für den Bürger besser sicherstellen zu Können. Das Niedersächsische Landeskabinett setzte am 14. September 1965 eine Sachverständigenkommission mit dem Auftrag ein, Vorschläge für eine Neuordnung der Regierungs- und Verwaltungsbezirke des Landes Niedersachsen zu entwerfen. Die Sachverständigenkommission wurde nach ihrem Vorsitzenden, dem Göttinger Staats- und Kommunalwissenschaftler Prof. Dr. Werner Weber, Weber Kommission genannt. Im März 1969 veröffentlichte der Niedersächsische Innenminister das fertiggestellte Gutachten.
Gemeindereform
Als erster Schritt auf dem Wege zur Gebiets- und Verwaltungsreform wurde die Gemeindereform in Angriff genommen. Im überwiegend ländlich strukturierten Niedersachsen war die Gemeindegliederung zu kleinteilig. Annähernd die Hälfte aller Gemeinden, nämlich 2.080, hatte weniger als 500 Einwohner. Die Verwirklichung der im Gutachten vorgeschlagenen Gemeindemindestgröße von 7.000- 8.000 Einwohnern hätte im dünn besiedelten Emsland zu unüberschaubar großen Einheiten geführt. Nach intensiver Diskussion einigte man sich auf Größen von 5.000 Einwohnern, die möglichst nicht unterschritten werden sollten. Durch die Neugliederungsgesetze zur Gebietsreform wurden in den drei Kreisen des Emslandes in den Jahren 1973 und 1974 aus ehemals 161 selbständigen Gemeinden 20 Einheits- und Samtgemeinden gebildet.
Kreisrefom
Die Überlegungen zur Kreisreform waren davon geleitet, daß sich die Aufgaben der Kreisverwaltungen in Zukunft unter dem sozialstaatlichen Auftrag des Grundgesetzes stärker auf die Gebiete der Leistungsverwaltung und der Daseinsvorsorge verlagern würden. Die Kreise sollten eine aktivere Rolle bei der Gestaltung des Wirtschafts- und Soziallebens übernehmen. Sie sollten eine ausgleichende Gesamtverantwortung gegenüber dem Lebens- und Wirtschaftsraum des Kreisgebietes und seiner Bevölkerung ausfüllen. Eine der wichtigsten Aufgaben würde es sein, Strukturverbesserungen zu planen und durchzuführen. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, mußten ausreichend große Raumeinheiten geschaffen werden, die langfristig die gestellten Planungs- und Entwicklungsaufgaben, vor allem in Hinsicht auf Finanzierungs- und Investitionsprogramme, erfüllen konnten. Dazu gehörte es, daß die Kreise im Rahmen der gesamten öffentlichen Verwaltung auch Träger von Fachaufgaben werden müßten, die bisher von staatlichen Behörden wahrgenommen wurden.
Die Gründung des Landkreises Emsland
Unter diesen Voraussetzungen schlug die Sachverständigenkommission für die Neubildung der Kreise im Emsland vor, die Kreise Aschendorf Hümmling und Meppen sowie Lingen und Grafschaft Bentheim zusammenzuschließen. Bereits im Anhörungsverfahren zur Erstellung des Gutachtens hatte es im Emsland Widerstände gegen diese Lösung gegeben. Nach einem langwierigen politischen Entscheidungsprozeß, nicht zuletzt beeinflußt durch den Regierungswechsel 1976, kam es schließlich am 1. August 1977 zur Bildung eines Großkreises Emsland aus den Kreisen Aschendorf Hümmling, Meppen und Lingen mit Kreissitz in Meppen und Außenstellen in Papenburg (Aschendorf) und Lingen. Aus dem Kreis Lingen wurde die Gemeinde Wietmarschen ausgegliedert und dem Kreis Grafschaft Bentheim zugeschlagen. Nach der Kreistagswahl vom 23. Oktober 1977 wählte der Kreistag auf seiner konstituierenden Sitzung am 22. November den Abgeordneten Klaus Stricker einstimmig zum ersten Landrat des Landkreises Emsland. Auf derselben Sitzung wurden auch der Regierungsvizepräsident Karl-Heinz Brümmer zum Oberkreisdirektor gewählt, nachdem er bereits seit dem 1. September 1977 das Amt kommissarisch ausgeübt hatte.
Das neue Kreishaus in Meppen
Die verschiedenen Ämter der Kreisverwaltung waren am Kreissitz Meppen in eigenen oder angemieteten Räumen untergebracht, so daß im Laufe der Zeit 15 unterschiedliche Büroadressen existierten. Die Kreisreform 1977 erforderte nun eine umfassende Neuorganisation der Kreisverwaltung. So erklärte der Kreistag bereits am 6. März 1978 seine grundsätzliche Bereitschaft zur Errichtung eines zentralen neuen Kreishauses in der Orde in Meppen. Nachdem die Planungen und der Architektenwettbewerb abgeschlossen worden waren, erfolgte der erste Spatenstich am 2. August 1982, gut ein Jahr später, am 6. September 1983 feierte man das Richtfest. Der 10. Dezember 1984 war ein herausragender Tag in der Geschichte des Landkreises Emsland: Zum ersten Mal konnte der Kreistag des Landkreises Emsland im großen Sitzungssaal des neuen Kreishauses zusammentreten. Das neue Gebäude wurde auf einer Fläche von 5.569 m2 errichtet, es ist 130 m lang, 114 m breit und 12 m hoch; insgesamt wurden rund 61.294m Raum umbaut. Die veranschlagten Baukosten von 47,5 Mio. DM konnten unterschritten werden; tatsächlich wurden 42 Mio. DM verbaut . Es wurde als Dienstleistungsbetrieb für die emsländische Bevölkerung, als Haus, das dem Bürger dienen und das Zusammengehörigkeitsgefühl im Emsland stärken soll , offiziell am 2. September 1985 seiner Bestimmung übergeben.
Die Kreisverwaltung heute
Von der Abfallwirtschaft bis zum Zivilschutz kümmern sich 1.230 Mitarbeiter des Dienstleistungsunternehmens Kreisverwaltung um die Belange der 295.500 Bürger im Landkreis Emsland. Die Modernisierung der Verwaltung wird Zug um Zug verwirklicht. So wurde beispielsweise das Amt für Abfallwirtschaft in einen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführten Eigenbetrieb des Landkreises überführt. Nach der Fusion von Meppen Haselünner Eisenbahn und Hümmlinger Kreisbahn am 1. Januar 1993 zur Emsländischen Eisenbahn ist diese zum 1. Januar 1997 in eine GmbH umgewandelt worden. Die Emsland Touristik GmbH kümmert sich seit neuestem um die Förderung des Fremdenverkehrs und die Vermarktung der touristischen Angebote im Emsland. Der Einzug der elektronischen Datenverarbeitung als Kennzeichen moderner Verwaltungsführung schreitet auf breiter Basis voran und soll noch weiter ausgebaut werden. In einem regelmäßig erscheinenden Verwaltungsbericht werden Leistungen, Veränderungen und Ziele auch für die Öffentlichkeit transparent gemacht.
Der 518 Seiten starke Haushaltsplan 1998 des Landkreises Emsland spiegelt Projekte, Perspektiven und Probleme einer selbstverwalteten Kommune, vor allem unter den finanzpolitisch schwierigen Rahmenbedingungen der öffentlichen Kassen am Ende des 20. Jahrhunderts wider. Dennoch versucht der Landkreis Emsland seinem Auftrag, Daseinsvorsorge für die Bürger zu betreiben, nicht zuletzt dadurch Rechnung zu tragen, daß erhebliche Mittel für die Wirtschaftsförderung zur Schaffung von Arbeitsplätzen aus verschiedenen europäischen und nationalen Förderprogrammen eingeworben und gleichfalls erhebliche Eigenmittel bereitgestellt werden.
Begleitet, unterstützt und parlamentarisch legitimiert wird die Arbeit der Kreisverwaltung vom Kreistag und seinen 14 Ausschüssen. Seit der Kommunalwahl vom 15. September 1996 setzt sich der Kreistag mit seinen 65 Mitgliedern unter Führung von Landrat Josef Meiners folgendermaßen zusammen: 44 CDU, 13 SPD, 3 Grüne, 2 FDP, 3 UWG.
Die nächsten Jahre werden wichtige Strukturveränderungen für die Kreisverwaltung mit sich bringen. Die zwei Hauptschwerpunkte dürften die schrittweise Verwirklichung der Verwaltungsreform unter dem Stichwort Neues Steuerungsmodell und der Ersatz der nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführten 'Doppelspitze' aus Landrat und Oberkreisdirektor durch einen direkt gewählten 'Landrat' spätestens im Jahre 2003 sein.
Bei Fragen zur Geschichte des Emslandes steht Ihnen als Ansprechpartner Herr Schüpp, Leiter des Kreisarchivs, unter der Telefon-Nr. 05931/44-461 zur Verfügung.
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!